Wie die Sardine in die Büchse kam und warum ein Arme-Leute-Essen so kostbar werden konnte.
von Daniel di Falco
Kann man Fische sammeln? Man kann. Sofern es sie in Dosen gibt. Vor allem aus Frankreich kommen seit einiger Zeit entsprechende Berichte. Gerade unter Leuten mit ausgefeilten kulinarischen Ambitionen habe sich eine Leidenschaft für ein Lebensmittel verbreitet, das anderswo immer noch als Billignahrung gilt: für Ölsardinen. Genauer noch: für die «sardines millésime», die Jahrgangssardinen. Zu ihnen kann man offenbar ein ähnliches Verhältnis haben wie zu Champagner oder Wein ‒ man kann sie hüten, und man kann sie reifen lassen. Eine Saison haben die Sardinen auch: Die besten Fänge soll es im September geben.
Erstklassige Fische also, erstklassiges Öl, erstklassige Verarbeitung ‒ und jetzt ab damit in die Dosen, die der Liebhaber lagern und alle sechs Monate einmal wenden wird, damit das Öl den Fisch schön durchwirken kann. Das ist auch der Grund, warum renommierte Produzenten die Sardinen nicht so eng in die Büchsen packen wie in der Redensart. Bis acht Jahre liegen sie dann in ihrer letzten Ölung, dann kommt der Tag, und auf dem Teller landet ein Glück, zu dem es angeblich nicht mehr braucht als Weisswein und einen Bissen Brot. Der Geschmack? Er sei, heisst es, mit jenem ordinärer Ölsardinen unmöglich zu vergleichen.
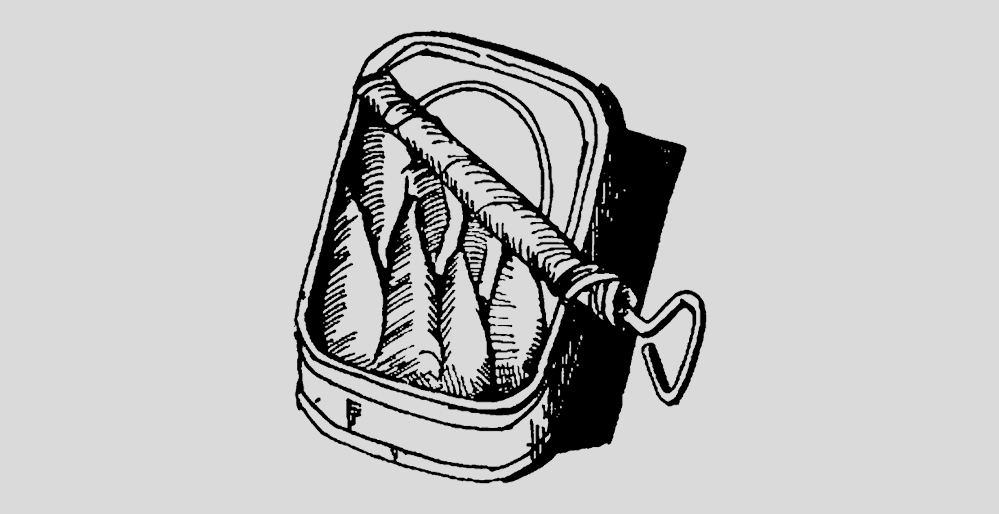
Wirklich? Es gab ihn ja schon, jenen Moment seinerzeit in der Bretagne, als der Garçon einen Teller brachte, und darauf lag statt der vermeintlich frischen Sardinen eine frisch geöffnete Blechdose. Dumm nur, dass die Erinnerung bloss vom Erstaunen über jene Dose handelt, nicht aber von den Sardinen selber. Und für die Erkenntnis, dass einem diese stumme Dose etwas sagen wollte, ist es jetzt zu spät. Dabei hat es durchaus seine Logik mit der sonderbaren Karriere der Konserve.
Tatsächlich war das Essen aus der Büchse zunächst ein Luxus: Wie eigentlich bei jeder Entwicklung der Lebensmittelindustrie waren die Wohlhabenden die ersten Kunden vor dem breiten Publikum. Nicolas Appert also, Franzose und von Haus aus Konditor, experimentierte Ende des 18. Jahrhunderts mit einem Verfahren, das schliesslich seinen Namen tragen sollte: mit der «Appertisation», der Sterilisierung von Lebensmitteln durch Erhitzen unter Vakuum; wenn auch noch in Gläsern. Das war Hightech damals, und es interessierte zuerst den Staat, der seine Soldaten und seine Seefahrer mit Vorräten ausrüsten wollte, die nicht verderben sollten.
«Wir haben ein dickflüssiges Gelée vorgefunden, das ein Stück Rindfleisch und zwei Stück Geflügel umschloss», rapportierten 1809 die Vertreter einer Expertenkommission, die einige von Apperts Gläsern zu Prüfungszwecken geöffnet hatten. Das Fleisch war «sehr zart», und auch die Brühe schmeckte den Fachleuten «vortrefflich»: «Obwohl sie vor fünfzehn Monaten zubereitet worden war, konnte man durchaus keinen Unterschied feststellen zu einer, die man am selben Tag gemacht hätte.»
Eine Zeitmaschine, die die Gesetze des natürlichen Verfalls aufhob ‒ die Konserve war eine Sensation. So holte sich der französische Zuckerbäcker auch die Prämie im Wettbewerb, den seine Regierung ausgeschrieben hatte. «Monsieur Appert hat die Kunst entdeckt, die Jahreszeiten stillstehen zu lassen; bei ihm ist das ganze Jahr hindurch Frühling, Sommer und Herbst.» So stand es damals in einer Zeitung. Und es war keineswegs zivilisationskritisch gemeint: Essen in «Harmonie mit der Natur» ‒ das ist eine Idee unserer Zeit. Und zur Obsession konnte sie erst werden, nachdem die Lebensmittelindustrie Schluss gemacht hatte mit den Launen genau jener Natur, der die Menschen bis dahin ganz unharmonisch ausgeliefert waren: Bis ins 19. Jahrhundert führten witterungsbedingte Missernten regelmässig zu Versorgungskrisen und zu Hungersnöten. Auch in Europa, auch in der Schweiz.
Was da also lagert und reift in den Sardinendosen, gehütet von Zuwendung und Olivenöl, das ist älter als acht Jahre, und es ist auch nicht bloss ein Fisch: Es ist die ganze Geschichte einer Zivilisation, die sich zuerst von der Natur emanzipieren musste, bevor sie sich den Luxus leisten konnte, sie zu lieben. Die Konserve ist zwar ein Medium der Technik für die Natur. Dass die Liebhaber der Dosensardine an ihr aber gerade das Echte und das Reine schätzen, das Unverfälschte und Ursprüngliche, und dass sie sich ihre Delikatesse mehr kosten lassen als ganz normalen Büchsenfisch ‒ das alles ist, im Lichte der Geschichte, dann eben doch kein Widerspruch.
